Chartanalyse lässt sich auch ohne komplexe Indikatoren anwenden. Eine strukturierte Vorgehensweise mit Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsbereichen, Formationen, Candlesticks und Volumen schafft einen klaren Rahmen. So entsteht ein nachvollziehbarer Leitfaden, der sich auf unterschiedliche Märkte wie Forex, Indizes und Aktien übertragen lässt.
Grundlagen der Technischen Analyse: Klarheit und Struktur
Charttechnik soll verständlich und überschaubar bleiben. Im Mittelpunkt stehen vier Kernfragen:
- Trend: In welche Richtung bewegt sich der Markt?
- Zonen: Wo liegen Unterstützungen und Widerstände?
- Muster: Welche Formationen oder Candlesticks deuten mögliche Einstiege oder Ausstiege an?
- Zeitebenen: Welche liefern Strategie, welche das Timing?
Wer diese Punkte Schritt für Schritt prüft, erhält eine klare und nachvollziehbare Basis für die Analyse.

9-Schritte-Checkliste für eine strukturierte Chartanalyse
Die Checkliste soll helfen, Charts systematisch zu analysieren. Jeder Punkt ist klar definiert und lässt sich praktisch anwenden.
1. Trend im Chart erkennen

Am Anfang steht die Frage: Bewegt sich der Markt nach oben, nach unten oder seitwärts?
Dafür werden markante Hochs und Tiefs eingezeichnet und mit einer Trendlinie verbunden. Auf Tagesbasis bedeutet ein Abwärtstrend oft, dass Verkaufssignale im Vordergrund stehen. In einem Aufwärtstrend dominieren dagegen Kaufsignale.
Vorgehen:
- Chart ausdrucken oder am Bildschirm vergrößern
- Hochs und Tiefs markieren
- Trendlinie über mindestens zwei Punkte ziehen (drei erhöhen die Aussagekraft)
- bei Bedarf einen Trendkanal ergänzen (parallele Gegenlinie)

2. Trendlinien: Unterstützungen und Widerstände bestimmen
Horizontale Zonen zeigen, wo der Markt wiederholt reagiert. Besonders wichtig sind Bereiche mit Polaritätswechsel – wenn Widerstand zu Unterstützung wird oder umgekehrt.
Praktische Hinweise:
- Mehrfache Berührungen ohne Durchbruch = starke Zone
- Enge Abfolge von Hochs in kurzer Zeit = Widerstandszone
- Enge Abfolge von Tiefs = Unterstützungszone
- Bei Durchbruch auf Bestätigung warten: Rebreak oder Pullback als Filter verwenden.

3. Chartformationen systematisch einordnen
Dreiecke, Flaggen, W- und M-Formationen sowie die Schulter-Kopf-Schulter (SKS) liefern klare Kursziele. Ihre Aussagekraft steigt, wenn sie im Kontext von Trend und Unterstützungs-/Widerstandszonen betrachtet werden. Sie sind Bestandteil der technischen Analyse.
Praktische Hinweise zu Formationen:
| Formation | Merkmale | Kursziel-Bestimmung |
|---|---|---|
| Symmetrisches Dreieck | Verengende Hochs und Tiefs | Breite an der breitesten Stelle messen und in Ausbruchsrichtung projizieren |
| Ansteigendes Dreieck | Horizontale Widerstände, steigende Tiefs → oft bullisch | Breite als Ziel verwenden |
| Fallendes Dreieck | Horizontale Unterstützungen, fallende Hochs → oft bärisch | Breite als Ziel verwenden |
| Flagge/Wimpel | Kurze Konsolidierung nach einer Fahnenstange | Länge der Fahnenstange am Ausbruchsniveau antragen |
| Schulter-Kopf-Schulter | Drei Gipfel, mittlerer am höchsten; nach langer Trendphase besonders stark | Abstand zwischen Kopf und Nackenlinie messen und nach Bruch projizieren |

4. Candlestick-Muster als Marktstimmung nutzen
Candlestick-charts zeigen den Druck zwischen Käufern und Verkäufern. Es reicht, Länge und Farbe im Kontext zu lesen – alle Chartmuster auswendig zu lernen ist nicht nötig.
| Candlestick-Muster | Bedeutung |
|---|---|
| Lange weiße Kerze nach Ausbruch | Signal für Kaufdruck |
| Lange rote Kerze mit Volumen | Bestätigung von Verkaufsdruck |
| Piercing Pattern, Engulfing, Doji, Hammer | Hinweis auf mögliche Trendwende, aber nur im Kontext verlässlich |
„An der Börse gibt es entweder mehr Aktien als Dummköpfe oder mehr Dummköpfe als Aktien.“– André Kostolany
Dieser Satz zeigt das Wesentliche: Marktstimmung bestimmt die Richtung. Kerzen sind Indikatoren für das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern.

5. Volumen als Bestätigung einsetzen
Volumen bestätigt Bewegungen. Fehlt der Zuwachs, steigt die Gefahr von Fehlausbrüchen.
- Ausbruch mit steigendem Volumen → höhere Wahrscheinlichkeit für Fortsetzung
- Starke Bewegung ohne Volumen → Warnsignal für Schwäche
- Volumen-Spikes an Extremen → oft Marktbereinigung oder Ausverkauf

6. Zeitebenen kombinieren für Strategie und Timing
Die Verbindung von Strategie-Zeitebene und Timing-Zeitebene ist entscheidend. Wochen- und Monatscharts zeigen die übergeordnete Richtung. Tages- und Stundencharts liefern die Signale für Ein- und Ausstieg.
Vorgehen:
- Auf Monats- oder Wochenbasis den Haupttrend und große Formationen bestimmen
- Auf Tagesbasis Unterstützungs- und Widerstandszonen markieren
- Auf Stunden- oder 15-Minuten-Charts nach Timing-Signalen wie Breakouts, Pullbacks oder Kerzenmustern suchen

7. Technische Chartanalyse: Kursziele und Stop-Loss festlegen
Kursziele entstehen aus Formationen, Trendkanälen oder Projektionen wie der Flaggen-Methode. Der Stop-Loss schützt die Handelsidee, nicht das gesamte Depot.
Methoden zur Ziel- und Stop-Bestimmung:
- Formationsprojektion: Breite am Ausbruchsniveau antragen (z. B. Dreieck, Flagge)
- Trendanalyse: Schwankungsbreite des Trendkanals projizieren
- Indikator-Stops: z. B. gleitende Durchschnitte, Supertrend, Parabolic SAR
Positionierung nach Stop-Abstand:
- Stop-Abstand bestimmen (Pips oder Prozent)
- Risikobudget pro Trade festlegen (z. B. 1 % des Kontos)
- Positionsgröße = Risikobudget ÷ Stop-Abstand
Beispiel: Einstieg 1,0600 – Stop 1,0300 = Risiko 300 Pips. Bei 1 % Risikobudget ergibt sich die passende Positionsgröße.
Kursziele entstehen aus Formationen, Trendkanälen oder Projektionen wie der Flaggen-Methode. Der Stop-Loss schützt die Handelsidee, nicht das gesamte Depot.
Methoden zur Ziel- und Stop-Bestimmung:
- Formationsprojektion: Breite am Ausbruchsniveau antragen (z. B. Dreieck, Flagge)
- Trendanalyse: Schwankungsbreite des Trendkanals projizieren
- Indikator-Stops: z. B. gleitende Durchschnitte, Supertrend, Parabolic SAR
Positionierung nach Stop-Abstand:
- Stop-Abstand bestimmen (Pips oder Prozent)
- Risikobudget pro Trade festlegen (z. B. 1 % des Kontos)
- Positionsgröße = Risikobudget ÷ Stop-Abstand
Beispiel: Einstieg 1,0600 – Stop 1,0300 = Risiko 300 Pips. Bei 1 % Risikobudget ergibt sich die passende Positionsgröße.

8. Fehlerquellen vermeiden und mentale Stärke entwickeln
Subjektive Verzerrungen beeinflussen Interpretation.
| Häufige Fehler | Gegenmaßnahmen |
|---|---|
| Analyse durch vorhandene Positionen beeinflusst | Regelwerk erstellen und konsequent anwenden |
| Überladene Charts durch zu viele Indikatoren | Trading-Journal führen: Entscheidung, Ergebnis, Lernpunkte |
| Angst → zu frühes Schließen von Gewinnern | Mentales Training: Umgang mit Verlusten und Gewinnen üben |
9. Persönliches Regelwerk für Trader: Disziplin und Routine
Ein klares Regelwerk schafft Disziplin und Reproduzierbarkeit. Wichtige Bausteine:
- Checkliste vor jedem Trade: Trend, Zonen, Volumen, Zeitrahmen, Stop/Target
- Risikomanagement-Regeln: Maximalrisiko pro Trade, tägliches Verlustrisiko, Hebelbegrenzung
- Regeln für Teilgewinne und Trailing-Stops
- Review-Routinen: wöchentliche und monatliche Analyse
Wer diese Regeln schriftlich festhält und regelmäßig prüft, verringert emotionale Fehler und verbessert die Lernkurve.
Chartanalyse in der Praxis: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Schritte lassen sich direkt am Chart anwenden – digital oder klassisch mit Bleistift und Lineal.
- Zeitrahmen wählen: Wochen- oder Monatschart für die Marktrichtung
- Hochs und Tiefs markieren: die letzten 6–12 Monate berücksichtigen
- Trendlinien und Kanäle ziehen: mindestens zwei Berührungspunkte, besser drei
- Unterstützungs- und Widerstandszonen horizontal einzeichnen
- Formationen erkennen: Dreieck, Flagge, SKS, W- oder M-Formationen
- Volumen prüfen: begleitet es den Ausbruch oder nicht?
- Auf Tages- oder Stundencharts wechseln für das Timing: Breakout, Pullback, Candlestick-Muster
- Stop-Loss und Take-Profit setzen; Positionsgröße berechnen
- Trade dokumentieren: Plan, Einstieg, Ziel, Stop und Begründung ins Journal

Chartanalyse lernen: Kursziel-Bestimmung mit Praxisbeispielen
Die einfachsten und bewährten Methoden:
Kursziel-Methode: Dreieck-Formation
Die Breite der Basis messen und am Ausbruchsniveau antragen. Bei einem symmetrischen Dreieck die breiteste Stelle verwenden, meist vor dem zweiten Berührungspunkt.
Kursziel-Methode: Flaggen und Wimpel
Die Länge der Fahnenstange messen und am Ausbruchsniveau antragen. Besonders treffsicher nach einer starken, impulsiven Bewegung.
Kursziel-Methode: Schulter-Kopf-Schulter-Formation
Den Abstand zwischen Kopf und Nackenlinie messen und in Bruchrichtung projizieren. Je länger die vorausgehende Trendphase, desto verlässlicher das Ziel.
Kursziel-Methode: Projektion aus Trendkanälen
Die Schwankungsbreite eines Trendkanals messen und bei einem Ausbruch in Gegenrichtung antragen. Geeignet für Erholungen nach längerem Abwärtstrend oder als Ziel bei Short-Eröffnungen nach Aufwärtstrendbrüchen.
Stop‑Loss-Varianten und Trailing‑Mechanismen
Ein Stop-Loss schützt nicht das ganze Depot, sondern die Handelsstrategie hinter einem Trade. Technische Indikatoren sind hilfreiche Tools.
- Fixed Stop: fester Abstand in Pips oder Prozent unter/über dem Einstieg
- Volatilitätsstop: ATR-basiert (z. B. 1,5 × ATR), berücksichtigt die Marktvolatilität
- Indikatorstop: orientiert sich am Bruch eines gleitenden Durchschnitts oder eines Supertrend-Signals
- Trailing Stop: nachlaufender Stop, um Gewinne laufen zu lassen, z. B. mit gleitendem Durchschnitt
Wichtig: Der Stop-Abstand bestimmt die Positionsgröße. Ein größerer Stop bedeutet eine kleinere Position bei gleichem Risiko.

Fehlausbrüche und Bärenfallen erkennen
Fehlausbruch (false breakout) erkennt man oft an:
- schwachem Volumen beim Ausbruch,
- schneller Gegenbewegung innerhalb weniger Kerzen,
- kein Retest des Ausbruchsniveaus, sondern sofortiger Reversal.
Bärenfallen (False Breaks nach unten) können günstige Einstiegsgelegenheiten bieten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Ausbruch nach unten wird schnell zurückerobert (Rebreak in Range),
- Volumen bei Rückeroberung steigt,
- übergeordnete Zeitebenen unterstützen mögliche Erholung.

Chartanalyse im Alltag: Tipps für Berufstätige
Wer neben Beruf oder Studium tradet, muss die Zeitebenen klar trennen. Wochen- und Monatscharts zeigen die großen Formationen und die Trendrichtung. Der Tageschart liefert das Timing für Einstiege nach Pullback oder Breakout. Der Stundenchart ist nur für die Feinabstimmung am Tag eines erwarteten Ausbruchs nötig.
So bleibt die Analyse schlank und erfordert keine ständige Überwachung der Plattform.

Performance messen und Lernprozesse im Trading nutzen
Trading ist ein Lernprozess. Wichtige Bausteine der Performance-Kontrolle lassen sich klar strukturieren:
| Thema | Inhalt |
|---|---|
| Trading-Journal | Plan, Ausführung, Ergebnis und Lernpunkte festhalten |
| Reviews | Wöchentlicher Quick-Check, monatlich ausführliche Analyse |
| Kennzahlen | Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis, maximaler Drawdown |
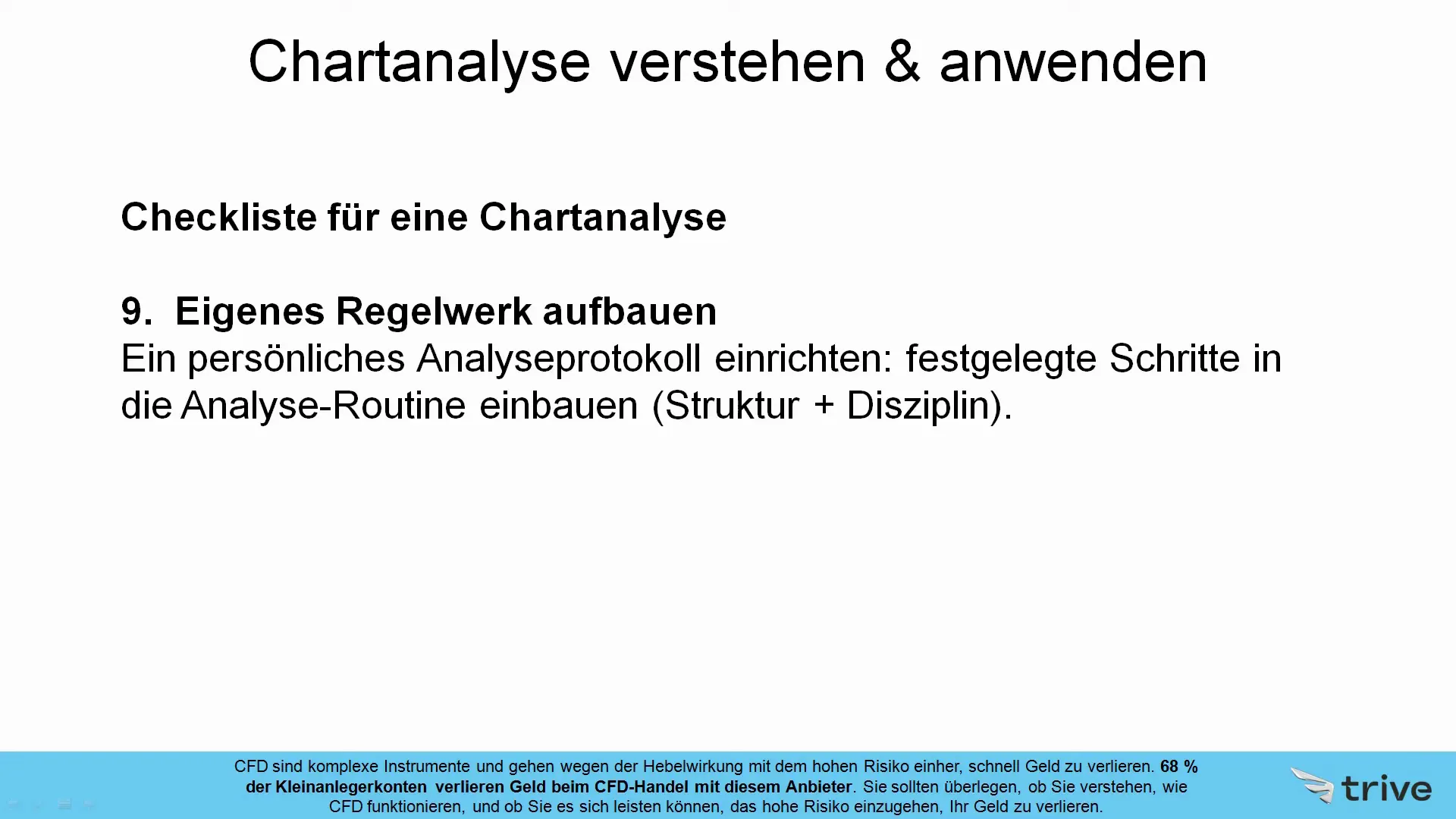
Kernbotschaften der Chartanalyse-Checkliste
- Chartanalyse funktioniert ohne Überfrachtung: Bleistift, Lineal und eine klare Checkliste genügen
- Trend, Zonen, Formationen, Kerzen und Volumen sind die Hauptpfeiler
- Zeitebenen kombinieren: übergeordneten Trend definieren, kurzfristig timen
- Stop-Loss schützt die Idee; die Positionsgröße muss zum Stop passen
- Ein eigenes Regelwerk und ein Trading-Journal fördern Disziplin und Lernkurve
Software für die Chartanalyse

Der Broker Trive bietet diverse Software Lösungen für charttechnische Analyse und technische Trader. Neben dem MetaTrader 5, MetaTrader 4 gibt es auch den Trive Trader. Der Trive Trader hat TradingView bereits integriert.
Alle Plattformen bieten diverse technische Indikatoren zur Wertpapieranalyse. Von einfachen Indikatoren wie den RSI, den Bollinger Bändern oder Fibonacci Retracements, bis hin zu komplexeren Tools.
Neben der Handelsplattform gibt es noch externe Anbieter wie Trading Central. Diese liefern automatische Analysen von Aktien, Forex, Indizes, Rohstoffen und Kryptos.
Wichtige Hinweise zu Anlageinformationen und Risiken
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die vorgestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine individuelle Anlageempfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich die Meinung des Autors wider. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zu erheblichen Verlusten des investierten Kapitals führen, zusätzlich zu den Renditen. Wenn das Wertpapier in einer anderen Währung als dem Euro gekauft wird, kann der Investor auch Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
Trive Financial Services Europe Limited ist eine autorisierte Investmentfirma gemäß dem Investment Services Act (Kapitel 370 der Gesetze von Malta) und wird von der Malta Financial Services Authority (MFSA) unter der Autorisierungs-ID „CRES“ reguliert. Die registrierte Adresse lautet Floor 5, The Penthouse, Lifestar, Testaferrata Street, Ta‘ Xbiex, Malta. Die Zweigniederlassung von Trive Financial Services Europe Limited in Deutschland ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registrierungsnummer 10161621 eingetragen.

Markus ist Deputy Country Head Germany bei Trive Financial Services Europe Limited. Er betreut zusätzlich einen deutschsprachigen Finanzblog, auf dem er praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn teilt. Mit über 16 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche hat er seine Leidenschaft für das Trading während seines BWL-Studiums in Frankfurt entdeckt. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.